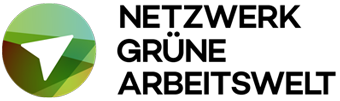Neuigkeiten von NGA-Mitgliedern
Mehr Sichtbarkeit für grüne Berufe

Neue Publikationsreihe des Netzwerkbüros Bildung Rheinisches Revier
Angesichts der aktuellen Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft stellt die stärkere Sichtbarkeit grüner Berufe in der Berufsorientierung einen wichtigen Baustein dar, um junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Doch welche Formate und Ansprache braucht es, um zielgruppengerechte Zugänge zu ermöglichen? Um das herauszufinden hat das Netzwerkbüro Bildung Rheinisches Revier (NBR) Schüler*innen im Übergangssektor an Berufskollegs befragt und zentrale Ergbenisse zusammengefasst.
Gastbeitrag: Marie Dufri Holmgaard, Netzwerkbüro Bildung Rheinisches Revier
Im vergangenen Jahr baute das Netzwerk Bildung Rheinisches Revier (NBR) sein Netzwerk mit zahlreichen Akteur*innen in der Berufsorientierung weiter aus, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie eine Weiterentwicklung der Berufsorientierung hin zu höherer Sichtbarkeit von grünen Berufen aussehen könnte. Aus den Gesprächen kristallisierten sich folgende zwei Ziele für die Berufsorientierung heraus:
- Eine grüne Arbeitswelt verständlich machen: Hier geht es um eine zielgruppenspezifische Ansprache, damit Entwicklungen im Bereich der Green Economy für Jugendliche nachvollziehbar werden.
- Das Berufswahlspektrum erweitern: Die Auseinandersetzung mit Veränderungen innerhalb bestehender Berufe und die Schaffung von Zugängen zu neuen Berufsfeldern, z. B. im Bereich erneuerbarer Energien.
Nachhaltigkeitsthemen im Bereich green Economy sowie globale und lokale Transformationsprozesse sind komplexe Themen und an mancher Stelle schnell politisch oder normativ gefärbt. Dies stellt die Berufsorientierung vor besondere Herausforderungen und wirft die Frage auf, welche Formate und Ansprache geeignet sind, um zielgruppengerechte Zugänge zu ermöglichen. Um dies zu beantworten, führte das Netzwerkbüro Gruppeninterviews mit Schulklassen im Übergangssektor an Berufskollegs durch (Holmgaard 2024a). Im ersten Ergebnisbericht (Holmgaard 2024b) wird ein Teil der vielseitigen Ergebnisse mit Fokus auf die Lebenswelt der interviewten Schüler*innen dargestellt. Ziel war es, die Lebenswelt der Jugendlichen zu verstehen und zentrale Einflussfaktoren ihrer Berufswahl zu identifizieren. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus dem Bericht vorgestellt.
Lebenswelt geprägt von Krisen und Unsicherheiten
Die Lebenswelt junger Menschen (Familie, Schule, Peer-Netzwerk) war in den letzten Jahren stark von Krisen geprägt. Diese Unsicherheiten hinterlassen ihre Spuren. In den Interviews wurde eine deutliche Sorge um die materielle Absicherung geäußert. Viele Jugendliche hatten das Gefühl, dass ihnen durch die Vielzahl an Krisen und Veränderungen fortlaufend etwas genommen wird. Politische Maßnahmen werden dabei oft nicht als Lösung wahrgenommen, sondern als Verstärkung bestehender Unsicherheiten. Dieses Gefühl des Mangels kann die Berufswahl dahingehend beeinflussen, dass Faktoren wie die berufliche Sicherheit und Verdienstmöglichkeiten im Entscheidungsprozess an Bedeutung gewinnen könnten (vgl. Holmgaard 2024b, S. 8).
Familiäre Berufsnachfolge
Eltern haben einen erheblichen Einfluss auf die Berufsentscheidung ihrer Kinder. In Gesprächen mit ihren Kindern zur Berufswahl orientieren sich Eltern häufig an den Berufen, die sie selbst ausüben oder die ihnen aus ihrem Umfeld vertraut sind. Diese (un)bewusste Lenkung der Eltern beeinflusst das Berufswahlspektrum dahingehend, dass Schüler*innen viel mehr Einblicke und Berührungspunkte mit Berufen aus ihrem sozialen Umfeld erhalten und hierdurch leichter einen Zugang und Bezug zu diesen Berufen finden. Das erklärt, warum viele Jugendliche Berufe wählen, die bereits in ihrer Familie vertreten sind. In den Interviews war die familiäre Berufsnachfolge deutlich ausgeprägt: Mit wenigen Ausnahmen wollten die Schüler*innen Berufe ergreifen, die in ihrer Verwandtschaft bereits ausgeübt wurden. Das „Vererben“ von Berufen führt dazu, dass immer wieder dieselben Berufe gewählt werden, und andere außer acht geraten. Neu entstehende Berufe und Berufsfelder geraten hier in ein Bekanntheitsdefizit. An dieser Stelle kommt der Berufsorientierung eine zentrale Aufgabe zu: Schüler*innen sollen vielfältige Berufsfelder kennenlernen und vor allem durch Begegnungen einen Bezug dazu entwickeln.
Institutionelle Einflussfaktoren
Eine mögliche Hürde bei der Erweiterung des Berufswahlspektrums zeigt sich in den Strukturen der Berufsfachschulen. Schüler*innen in den Berufsfachschulen 1 und 2 dürfen Praktika nur in Berufen absolvieren, die ihrer gewählten Fachrichtung entsprechen. In den Interviews wurde deutlich, dass viele Jugendliche zwar einem bestimmten Bildungsgang zugeordnet sind, sich aber noch nicht für einen konkreten Beruf entschieden haben. Diese Schüler*innen bemängelten, dass sie nicht uneingeschränkt Berufe kennenlernen können und sich in ihrem Entscheidungsspielraum eingegrenzt fühlen. Die Ausgestaltung von Berufsorientierung muss diese Rahmenbedingungen berücksichtigen und die Möglichkeiten und Zwänge für die Beratenden und Jugendlichen erkennen.
Begrenzungen durch schulische Leistungen
Unzureichende schulische Leistungen oder familiäre Herausforderungen erschwerten im Übergangssektor häufig die Verwirklichung persönlicher beruflicher Ziele. In den Interviews schilderten Schüler*innen die Frustration, die mit dem Abbruch einer Ausbildung und der anschließenden Suche nach einem alternativen Berufswunsch einherging. Dieses Ergebnis rückt verschiedene Aspekte der Motivation in den Fokus, und es stellt sich die Frage: Wie kann trotz wiederholter Erfahrungen des Scheiterns im schulischen Kontext die Bereitschaft gefördert werden, einen erneuten Anlauf zu wagen? Unabhängig von der Sichtbarkeit grüner Berufe stellte sich dies als eine der zentralen Herausforderungen für die Gestaltung von Berufsorientierung heraus.
Die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft erfordert nicht nur den Wandel in der Arbeitswelt, sondern auch in der Art und Weise, wie wir junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten. Eine gezielte Berufsorientierung, die grüne Berufe sichtbar macht und weitere Perspektiven eröffnet, ist daher von entscheidender Bedeutung. Dabei geht es (1.) darum, den Jugendlichen die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen, und (2.) sollen sie in die Lage versetzt werden, sich aktiv mit den Veränderungen und Chancen einer grünen Arbeitswelt auseinanderzusetzen. Hierdurch werden sie dabei unterstützt, informierte Entscheidungen zu treffen und Teil einer nachhaltigen Zukunft zu sein.
Die Publikationsreihe: Berufsorientierung im Übergangssektor
Braucht es eine besondere Ansprache, um bestimmten Zielgruppen einen Zugang zu den sogenannten „grünen Berufen“ zu schaffen? Wie können diese Berufe in der Berufsorientierung sichtbar werden? Und wie kann über sie gesprochen werden, damit sie für Schüler*innen im Übergangssektor der Berufsschulen eine Berufswahloption werden? Um diese Fragen zu beantworten, hat das BMBF-geförderte Projekt Netzwerkbüro Bildung Rheinisches Revier (NBR) gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) und der Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) eine Arbeitsgruppe gegründet.
In diesem Rahmen führte das NBR Gruppeninterviews mit Schulklassen an Berufskollegs durch. Die vielfältigen Ergebnisse werden in mehreren kleineren Publikationen veröffentlicht:
Heft 1: BildungsRAUM Rheinisches Revier. Berufsorientierung im Übergangssektor I. Interviews mit Schüler*innen an Berufskollegs – eIn MethodenberIcht
Heft 2: BildungsRAUM Rheinisches Revier. Berufsorientierung im Übergangssektor II. Einflussfaktoren im Berufswahlprozess – Ein Ergebnisbericht